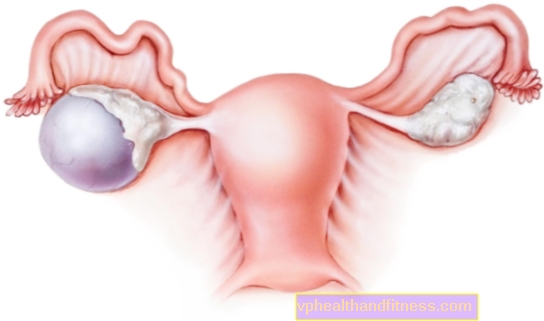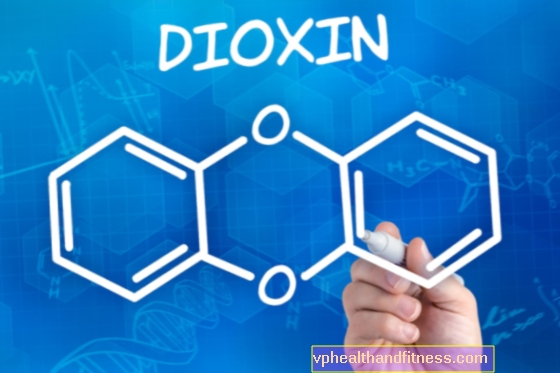Zu den kognitiven Funktionsstörungen gehören Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsprobleme sowie abnormale Empfindungen oder Pathologien im Zusammenhang mit Denkprozessen. Aufgrund der Tatsache, dass viele psychiatrische Symptome als kognitive Störungen eingestuft werden, bilden sie im Wesentlichen die Grundlage der Psychopathologie.
Kognitive Dysfunktion kann das Leben eines erfahrenen Patienten erheblich erschweren. Probleme können im Prinzip alle alltäglichen Situationen betreffen, sowohl die berufliche Funktionsweise (Schwierigkeiten können beispielsweise auf Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen zurückzuführen sein) als auch die familiäre Funktionsweise (hier können beispielsweise die Überzeugungen des Patienten, von denen er sich selbst dann sicher ist, problematisch und mit der Realität unvereinbar sein). wenn sie von seinen Verwandten abgelehnt werden). Kognitive Funktionsstörungen können aufgrund vieler Faktoren, die sie verursachen, sowohl bei einem Kind als auch bei einer älteren Person auftreten.
Kognitive Prozesse ermöglichen es den Menschen, etwas über die Umwelt zu lernen und mit ihr zu kommunizieren. Sie sind auch ein wesentliches Element im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Festigung von Wissen. Die grundlegenden kognitiven Prozesse des Menschen umfassen:
- Erinnerung,
- Beachtung,
- die Welt mit Hilfe der Sinne wahrnehmen,
- Denken.
Kognitive Funktionen werden von vielen verschiedenen Situationen beeinflusst. Beispiele hierfür sind:
- psychiatrische Probleme (z. B. Depressionen, bipolare Störungen oder Wahnsyndrome, aber auch ein traumatisches Ereignis),
- neurologische Erkrankungen (wie Schlaganfall, Alzheimer und andere Demenzsyndrome),
- Kopfverletzungen,
- Tumoren des Zentralnervensystems,
- schwere Exazerbationen chronischer somatischer Erkrankungen,
- die Verwendung von psychoaktiven Substanzen (z. B. Drogen oder Alkohol),
- Entzugssyndrome (im Zusammenhang mit dem Absetzen der Medikamente, von denen der Patient abhängig ist - dies kann beispielsweise den Entzug aus Alkohol, aber auch aus Medikamenten umfassen).
>> Lesen Sie auch: Abstinenzsymptome nach Drogenentzug: Opioide, Amphetamine, Kokain, Marihuana
Kognitive Beeinträchtigung: Gedächtnis
Gedächtnisstörungen werden in zwei Gruppen eingeteilt: quantitative und qualitative Gedächtnisstörungen.
Unter den quantitativen Gedächtnisstörungen (Dysmnesie) werden folgende unterschieden:
- Hypermnesie (außergewöhnlich gutes Gedächtnis),
- Hypomnesie (reduzierte Speicherkapazität),
- Amnesie (Mangel an Gedächtnis).
Die zweite Kategorie von kognitiven Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit dem Gedächtnis sind qualitative Störungen (Paramnesie). Diese Gruppe von Problemen umfasst:
- Gedächtniswahn (verzerrte Erinnerungen an Ereignisse, die tatsächlich in der Vergangenheit passiert sind)
- Kryptomnesie (Erinnerungen, deren Existenz dem Patienten nicht bekannt ist - infolge der Kryptomnesie kann das sogenannte unbewusste Plagiat begangen werden),
- Konfabulationen (falsche Erinnerungen, die normalerweise einige Gedächtnislücken im Patienten füllen).
>> Lesen Sie auch: Gedächtnisstörungen bei Jugendlichen, älteren Menschen nach einem Unfall
Kognitive Beeinträchtigung: Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeitsstörungen können in Form einer Konzentrationsstörung auftreten, wenn es schwierig ist, sich auf eine Aktivität zu konzentrieren. Es gibt auch eine übermäßige Verschiebung der Aufmerksamkeit (hin und wieder eine andere Angelegenheit) und eine unzureichende Verschiebung (eine Änderung der Fokusquelle ist für den Patienten schwierig).
Ein weiteres Problem ist die übermäßige Ablenkung, bei der selbst ein scheinbar unbedeutendes Ereignis (z. B. ein vorbeifliegendes Insekt) den Patienten vollständig von der Aktivität ablenkt, auf die er sich zuvor konzentriert hatte.
>> Lesen Sie auch: Möglichkeiten, sich gut zu erinnern
Lesen Sie auch: Emotional instabile Persönlichkeit: Impulsive und Borderline-Typen. Ursachen, vol ...Bewusstseinsstörungen (quantitativ und qualitativ) - Arten und Symptome Oeroid-Syndrom (traumhaft, verschwommen) - Ursachen, Symptome, BehandlungKognitive Beeinträchtigung: Wahrnehmung
Wahrnehmungsstörungen umfassen Illusionen, Halluzinationen und psychosensorische Störungen.
Illusionen (auch als Wahnvorstellungen bezeichnet) sind falsche Wahrnehmungen, die sich aus Reizen ergeben, die die Sinnesorgane erreichen. Es muss hier betont werden, dass nicht alle Illusionen mit Pathologie zusammenhängen. Ein Beispiel für eine Illusion kann der Eindruck sein, dass sich ein Fremder vor dem Fenster befindet, während sich gewöhnliche Äste dahinter befinden. Pathologische Wahnvorstellungen treten auf, wenn der Patient - trotz der logischen Darstellung, dass er falsch liegt - immer noch von der Wahrheit seiner Beobachtungen überzeugt ist.
Halluzinationen unterscheiden sich von Wahnvorstellungen. Ihre Bildung hängt nicht mit den Reizen zusammen, die den Patienten erreichen. Die Ähnlichkeit von Halluzinationen und Illusionen betrifft jedoch die Überzeugung des Patienten, dass die erlebten Erfahrungen wahr sind. Menschen, die Halluzinationen erleben, neigen nicht dazu, sich davon zu überzeugen, dass ihre Erfahrungen nicht real sind. Halluzinationen können jeden der Sinne beeinflussen, weshalb Halluzinationen unterschieden werden:
- auditorisch (verschiedene Geräusche oder Stimmen hören),
- visuell (z. B. eine Spinne an einer Wand sehen),
- olfaktorisch (Empfindung nicht vorhandener Gerüche),
- Geschmack (den Geschmack trotz des Fehlens eines Geschmacksreizes fühlen),
- sensorisch (z. B. ein Gefühl von Würmern am Körper).
>> Lesen Sie auch: Paranoia Paranoia - Ursachen, Symptome, Behandlung
Es gibt sogenannte die angebliche Form von Halluzinationen (sie werden auch Pseudohalluzinationen genannt). In diesem Fall befinden sich die abnormalen Empfindungen im Körper des Patienten oder in einem undefinierten Raum.
Ein weiteres Problem, das als Wahrnehmungsstörungen eingestuft wird, sind psychosensorische Störungen (Parahalluzinationen). Ihre Entstehung ähnelt der von Halluzinationen - diese Empfindungen entstehen ohne Beteiligung eines externen Reizes, aber ihr Unterscheidungsmerkmal ist, dass sich die Patienten ihrer Unwirklichkeit bewusst sind. Zu den psychosensorischen Störungen zählen unter anderem falsche Wahrnehmung der Größe von Objekten (wenn sie als zu klein wahrgenommen werden, werden sie als Mikropsien bezeichnet, während sie dem Patienten ungewöhnlich groß erscheinen, werden sie als Makropsien bezeichnet).
Im Verlauf psychosensorischer Störungen können unwirkliche Erfahrungen auch andere Sinne beeinflussen: Geruch, Hören, Geschmack oder Geruch.
Einige Klassifikationen für Wahrnehmungsstörungen umfassen zwei weitere Phänomene: Depersonalisierung und Derealisierung. Depersonalisierung ist ein Zustand, in dem sich eine Person von sich selbst losgelöst fühlt - dabei hat der Patient den Eindruck, tatsächlich auf der Seite zu sein und nur ein Beobachter seines Körpers zu sein. Im Falle der Derealisierung gibt es wiederum ein Gefühl der Veränderung in der umgebenden Welt - der Patient findet die Welt seltsam, seltsam und unwirklich.
>> Lesen Sie auch: Déjà vu: Wodurch wird es verursacht? Was bedeutet häufiges Déjà Vu?
Empfohlener Artikel:
Wahnvorstellungen - Ursachen. Was verursacht Wahnvorstellungen?Kognitive Beeinträchtigung: Denken
Denkstörungen werden in Kursstörungen, Inhalt und Logik des Denkens unterteilt. Ausdruck ist von Natur aus mit Denkprozessen verbunden, daher wird das Vorhandensein von Denkstörungen hauptsächlich durch jene Probleme nahegelegt, die beim Sprechen auffallen.
1. Bei Denkstörungen gibt es:
- Mutismus (völlige Beendigung des Sprechens, was mit einer Gedankenlücke verbunden sein kann),
- alogy (Denkarmut),
- das Rennen der Gedanken und die verwandten Wörter,
- Beschleunigung des Denkens,
- verlangsamen Sie Ihr Denken,
- Denkstörungen (plötzlicher Verlust eines Fadens, über den der Patient zuvor nachgedacht hatte),
- Ablenkung des Denkens (Verlust der Verbindungen zwischen einzelnen Gedankenfäden, was dazu führt, dass der Patient beim Sprechen unorganisiert von einem Thema zum anderen wechselt),
- Akribie (im Verlauf von Denkprozessen gibt es immer noch neue, zusätzliche Gedanken zu kleinen Angelegenheiten, die die Aussage des Patienten voller unnötiger Details machen),
- Beharrlichkeit (einen Satz viele Male wiederholen),
- Verbigerationen (Wiederholung von Wörtern, die einander ähnlich klingen)
- Echolalia (unbewusste, unvernünftige Wiederholung der Worte anderer Leute),
- Inkohärenz des Denkens (völliger Mangel an Übereinstimmung zwischen den Gedanken).
2. Weitere kognitive Störungen im Zusammenhang mit Denkprozessen sind Störungen des Denkinhalts. Darunter sind Wahnvorstellungen (falsche Überzeugungen), deren Wahrheit die Patienten so sicher sind, dass es unmöglich ist, sie davon zu überzeugen, dass sie falsch liegen. Das Thema Wahnvorstellungen kann variieren, aber Wahnvorstellungen sind am häufigsten:
- Verfolgung (der Patient glaubt, verfolgt und belauscht zu werden),
- referentiell - der Patient glaubt, dass er oder sie von besonderem Interesse für die Umwelt ist,
- Eifersucht
- Auswirkungen (der Patient glaubt, dass Dritte sein Verhalten von außen kontrollieren, z. B. durch einen unter die Haut implantierten Chip),
- erotisch,
- Gedanken senden oder empfangen
- Enthüllung (der Patient ist überzeugt, dass seine Gedanken ohne seine Teilnahme an Dritte weitergegeben werden),
- somatisch (der Patient spürt Symptome einer schweren oder tödlichen Krankheit),
- grandios (die kranke Person behauptet, eine berühmte, reiche und einflussreiche Person zu sein).
Innerhalb der inhaltlichen Denkstörungen werden auch überbewertete Ideen (Gedanken) und Obsessionen unterschieden. Überbewertete Gedanken werden gesagt, wenn der Patient von einer bizarren oder extrem absurden Idee in seinem Leben geleitet wird - normalerweise ordnet er sein Verhalten und sein Leben dieser unter. Überbewertete Gedanken können sich beispielsweise auf das Konzept konzentrieren, eine ungewöhnliche Erfindung zu schaffen. Was sie von Wahnvorstellungen unterscheidet, ist, dass der Patient annehmen kann, dass seine Überzeugungen nicht der Realität entsprechen.
Obsessionen sind wiederum aufdringliche (vom Patienten oft unerwünschte), wiederkehrende Gedanken. Am häufigsten konzentrieren sich Zwänge auf hygienische Aktivitäten und werden oft von Zwängen begleitet (Aktivitäten, für die der Patient den Zwang verspürt, sie auszuführen).
>> Lesen Sie auch: Symptome und Ursachen von Zwangsstörungen
3. Die dritte Gruppe von Denkstörungen sind Störungen in der Logik von Denkprozessen. Unter ihnen werden erwähnt:
- unlogisches Denken (während des Denkens zeichnet der Patient seine eigenen Ursache-Wirkungs-Beziehungen und bemerkt ungewöhnliche Zusammenhänge, die mit der allgemein akzeptierten Logik unvereinbar zu sein scheinen),
- magisches Denken (im Zusammenhang mit irrationalen, äußerst schwer verständlichen mentalen Zusammenhängen),
- Ambivalenz (das Auftreten völlig widersprüchlicher Gedanken),
- dereistisches Denken (losgelöst von der Realität).
Empfohlener Artikel:
DENKKRANKHEITEN - Typen. Störungen in Inhalt, Fortschritt, Struktur und Funktion ... Über den Autor
Lesen Sie weitere Artikel dieses Autors


---przyczyny-objawy-leczenie-zaburzenia-pamici-krtko--i-dugotrwaej.jpg)